Hauptmenü
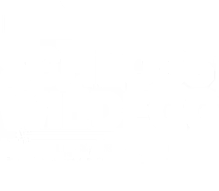
Bis zum Ende des 18. Jahrhunderte gehörten die meisten Wälder Adligen, Städten, Kirchen und Klöstern. Gesetze hinderten die Bevölkerung immer stärker daran, den Wald frei zu nutzen. Die Besitzenden beanspruchten Holz, Wild und Weiden für sich.
Im ganzen Aargau gab es auch Wälder, die als Allmenden bezeichnet wurden: Gebiete, die gemeinschaftlich von den jeweiligen Gemeinden bewirtschaftet wurden.
Je mehr die Bevölkerung wuchs, desto schlechter ging es dem Wald. Holz war bis ins 19. Jahrhundert der wichtigste Energieträger. Die Geschichte der Wälder ist auch eine Geschichte von Streit unter Menschen, wer den Wald wie nutzen darf.
Auch Kaspar Effinger, Herr von Wildegg, stritt 1489 mit den Untertanen um den Wald. Die Urkunde darüber, wie sich die Konfliktparteien geeinigt hatten, befindet sich bis heute im Archiv im Schloss Wildegg.
Kurz nachdem Kaspar Effinger die Burg 1483 gekauft hatte, geriet er in Streit mit den Bauern in Möriken, Wildegg und Holderbank. Die Auseinandersetzung zog sich über mehrere Jahre hin. Unter Kaspars Vorgängern hatten sich Gewohnheitsrechte entwickelt, auf die sich die Bevölkerung berief.
Doch Kaspar Effinger pochte auf seine im Kaufvertrag festgesetzten Rechte. Die Möriker Bauern hatten nach Ansicht des Schlossherrn selbstherrlich einen Förster eingesetzt, verkauften unrechtmässig Bau- und Brennholz und mästeten Schweine im Wald. Der Konflikt eskalierte, als die Möriker den Schlossknecht aus dem Chestenbergwald jagten.
Durch die Vermittlung Berns, durch die Landvogtei, konnten die beiden Konfliktparteien an den Verhandlungstisch geholt werden. Das Verhältnis zwischen Herrschaftsherr Effinger und Möriken konnte sich wieder normalisieren.

Der Druck auf den Wald stieg mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Der junge Schweizer Bundesstaat erliess mehrere Gesetze, um den Wald zu schützen: Waldbesitzer mussten fortan den Wald nachhaltig nutzen und durften nur so viel Holz ernten, wie nachwachsen konnte. Ab 1903 wurde das schweizweit geltende "Walderhaltungsgebot" gesetzlich verankert. Fast zwei Drittel des Waldes gehören heute Gemeinden, Kantonen und dem Bund.
Seit dem 20. Jahrhundert wächst der Wald in der Schweiz wieder. Doch auch heute drohen Gefahren: Hitze, Trockenheit aber auch aussergewöhnliche Unwetter bedrohen die Gesundheit des Waldes.